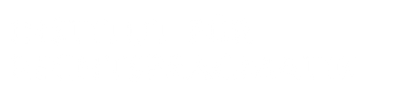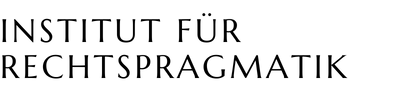Der US-amerikanische Brain Drain
Die Yale University, eine der renommiertesten Universitäten der USA, gab am 27. März 2025 den Verlust von drei ihrer prominentesten Professoren mit einer Meldung bekannt, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ: „Three prominent critics of President Donald Trump are leaving Yale’s faculty — and the United States — amid attacks on higher education to take up positions at the University of Toronto in fall 2025.“
Die Historiker Timothy Snyder and Marci Shore hätten bereits im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen im November beschlossen, dem Ruf der Munk School of Global Affairs and Public Policy zu folgen, hieß es weiter. Der Philosoph Jason Stanley habe seine Entscheidung, ebenfalls zur Munk School nach Toronto zu wechseln, mit dem politischen Klima in den USA begründet.
Shore wurde damit wiedergegeben, die Munk School habe sich bereits seit längerem um sie und ihren Ehemann Snyder bemüht. Das Paar habe zwei Jahre lang abgewogen, wie es sich verhalten solle. Auch ihre Kinder seien ein Faktor gewesen. Die historische Fakultät von Yale sei, wie es in der Meldung weiter heißt, um zwei ihrer prominentesten Forscher für Osteuropa ärmer. Zitiert wird der ukrainische Sprachwissenschaftlicher Olha Tytarenko, demzufolge der Weggang von Shore und Snyder ein tiefes Loch hinterlasse: “The intellectual and moral leadership they offered in advancing public understanding of Ukrainian history, culture, and politics at Yale is, in many ways, irreplaceable.”
In der gleichen Yale-Meldung wird der Leiter der philosophischen Fakultät, Paul Franks, damit zitiert, der Weggang von Stanley sei ein Schock. Weiterhin zitiert die Yale-Meldung Shore mit dem Satz, sie sei „heartbroken at what’s happened to my own country.” Sie gehe davon aus, dass viele ihrer Kollegen darüber nachdächten, die USA zu verlassen angesichts des Abstiegs der USA „into fascism.” Sie halte die Gefahr eines Bürgerkriegs für real.
Nota bene: Das steht in der Meldung einer Universität, die den Abgang ihres Lehrpersonals verkraften muss. Kein dürres ‚A und B folgten dem Ruf von X. Wir bedauern ihren Abgang, sind aber zuversichtlich, mit unserem weltweit renommierten Institut Y weiterhin Forscherinnen und Forscher von Weltrang auszubilden und zu rekrutieren.‘ Wie kommt Yale zu einer solch drastischen Meldung? Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung: Es handelt sich um einen Hilferuf. Eine der ältesten und reichsten Universitäten der USA, Mitglied der Ivy League, fürchtet, unter die Räder zu kommen. Ist diese Angst berechtigt?
Ein zunehmender Druck auf US-amerikanische Universitäten seitens der aktuellen US-Administration lässt sich nicht leugnen. So reagierte die Columbia-Universität auf staatliche Intervention hin mit einer Umgestaltung ihrer Fakultät für internationale Studien, um zu verhindern, dass ihr Gelder im Volumen von 400 Mio US-Dollar gestrichen würden. Bereits im Januar 2025 hatte Timothy Snyder einen persönlichen Rüffel des US-Vizepräsidenten erhalten, der auf X schrieb: „That this person is a professor at Yale is actually an embarrassment.“ Vance bezog sich auf eine Kritik, die Snyder im November 2024 an der geplanten Nominierung des US-Außenministers Hegseth geäußert hatte. Snyder hielt diese Maßnahme für den Teil eines ‚Decapitation strike‘, also eines strategischen Manövers, mit dem der – in diesem Fall innenpolitische – Gegner überrascht werden soll, so dass er nicht mehr zur Gegenwehr in der Lage ist.
Die eine Frage ist, wie sich der Widerstand gegen Gleichschaltung in den USA organisiert. Hierzu meinte Jason Stanley, er halte die Haltung US-amerikanischer Universitäten, möglichst keine Zielscheibe für Eingriffe der US-Administration abzugeben, für eine Strategie, mit der man nur verlieren könne. Sein Appell scheint gefruchtet zu haben: Bereits am 31. März 2023 veröffentlichten 1.900 Mitglieder der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine einen Aufruf an die US-amerikanische Öffentlichkeit, in dem sie um Unterstützung beim Kampf um den Weiterbestand einer unabhängigen Forschung in den USA baten, den sie bedroht sehen.
Das andere ist die Frage, wie die Welt außerhalb der USA reagieren sollte. Angesichts der Vokabeln, die von besonnenen Köpfen ins Spiel gebracht werden, muss man das Schlimmste befürchten: Abstieg in den Faschismus, Enthauptungsschläge gegen politische Gegner, drohender Bürgerkrieg, Kampf um die Wissenschaftsfreiheit – sind die USA noch zu retten?
Wir wissen es nicht. Was sich sagen lässt, ist, dass es seit Jahrzehnten Abgesänge auf die USA als Weltmacht gibt – hier sei nur an Emmanuel Todd’s 2002 erschienenen Verriss „Après l’empire. Essai sur la décomposition du système américain“ erinnert. Indes haben sich die Unkenrufe der letzten Jahrzehnte nicht bewahrheitet. Die USA sind nach wie vor der Weltpolizist, im Guten wie im Schlechten. Und doch ist die sich abzeichnende beispiellose innere oder äußere Emigration von Teilen der US-amerikanischen Eliten ernst zu nehmen. Wie soll sich der – demokratisch gesteuerte – Rest der Welt dazu verhalten?
Internationale Reaktionen: Eigennutz oder Solidarität?
Erste Reaktionen ließen nicht auf sich warten: In einem Gastbeitrag für ‚Spiegel online‘ fordern deutsche Wissenschaftler, ein Anwerbeprogramm für akademisches Spitzenpersonal aufzustellen, um den Wissenschaftsstandort und die Innovationskraft in Deutschland zu stärken. Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, geht auf Tour durch die Vereinigten Staaten, um Forschenden Deutschland als Alternative anzubieten. Auch andere EU-Staaten sind nicht tatenlos. So wirbt die französische Universität Aix-Marseille mit dem Programm Safe Place for Science um Forscher aus den USA. Und die Freie Universität Brüssel möchte Stellen für Exilanten aus den USA schaffen.
Dass es auch mit etwas mehr Fingerspitzengefühl geht, beweist die Präsidentin der Leibniz-Gesellschaft. Richtigerweise möchte sie davon absehen, aktiv Forschende aus den USA anzulocken. Von vorrangiger Bedeutung sei es, Kooperationen zu intensivieren und die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, ohne die amerikanische Wissenschaft gezielt zu schwächen. Man sieht: Europa schwankt zwischen Eigennutz und Solidarität. Worauf kommt es dabei an?
Das wurde an anderer Stelle in diesem Blog so beschrieben: „Die Forderung, Europa möge zusammenhalten, ist zu abstrakt und läuft ins Leere. Die Agenda muss konkreter sein, um Europa als Kulturkreis und Demokratiestandort zu stärken und für Leistungsträger weltweit begehrlich zu machen, die Schutz vor autoritären Regimen suchen. Das beste, was Europa tun kann, ist, einen attraktiven demokratischen Gegenraum zum grassierenden Autoritarismus zu schaffen.“
Die Formel dafür ist denkbar einfach: Solidarität ist das aus dem Wertesystem liberal-modern verfasster Demokratien resultierende Fundament, ein daraus für den Fortschritt dieser Demokratien folgender Nutzen die begrüßenswerte Folge. Um den Preis der Glaubwürdigkeit des Fundaments darf das Verhältnis nicht umgekehrt werden. Auch den Kompass gibt es schon: Es ist die Empathie mit den Betroffenen.
Aber wie setzt man die Formel konkret um? Auch hierfür liefert der Yale-Fall ein Beispiel: Profiteur des Weggangs der renommierten Forscher ist die Munk School of Global Affairs. Wer oder was ist die Munk School eigentlich, und wieso ist die Solidarität dieser Lehr- und Forschungseinrichtung so glaubwürdig, dass sie nicht ihrerseits in die Kritik gerät?
Philantropie als Antrieb
Die Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto wurde im Jahr 2010 aufgrund einer Spende ins Leben gerufen. Sie ist damit mehr als 300 Jahre jünger als die Yale University. Aber nicht darauf kommt es an. Ihr Gründer, Peter Munk, stammte aus Budapest und war Nachkomme ungarischer Rabbiner. Im Jahr 1944 entkam er knapp dem Holocaust und gelangte über die Schweiz mit einem Studenten-Visum nach Toronto. Nach Abschluss seines Studiums in Elektrotechnik gründete er mehrere Unternehmen und wurde zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Kanadas. Seinen philantropischen Einsatz für die Universität Toronto begründete Munk mit dem warmherzigen Empfang, der ihm entgegengebracht worden sei, als er 1948 als Migrant in Kanada ankam, “not speaking your language, not knowing a dog”.
Welchen besseren Ort hätten Historiker und Faschismus-Forscher, die sich in ihrem Heimatland in ihrer – wenn auch vorerst nur akademischen – Freiheit bedroht sehen, auswählen können, um eine Zuflucht zu finden, in der sie nicht bloß geduldet oder benutzt werden, sondern wahrhaft willkommen sind?
Und dann wäre da noch etwas: Ist es Zufall, dass die Hauptperson im kalten Herz Wilhelm Hauffs – war da nicht etwas? Ja, genau! – Peter Munk heißt? Für die drei Forscher, die Yale verlassen, mögen das böhmische – oder badische – Dörfer sein. Aber Europa sollte auch seine literarische Historie nicht vergessen: Das kalte Herz handelt vom Kohlenmunk-Peter, der die Köhlerei seines verstorbenen Vaters führt und davon träumt, reich und angesehen zu sein. Im Schwarzwald ruft er einen guten Geist, das Glasmännlein, mit den Worten an: „Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehn – lässt dich nur Sonntagskindern sehn“. Da Peter ein Sonntagskind ist, erfüllt ihm das Glasmännlein den Wunsch nach Geld, Tanzgeschick – und einer Glashütte. Doch Peter fehlt der kaufmännische Verstand. Er vernachlässigt seine Geschäfte und muss die Glashütte verpfänden. Um Hilfe zu erhalten, wendet er sich an den Holländermichel, einen bösen Geist, der ihm zwar zu neuem Vermögen verhilft, dafür aber sein Herz verlangt, an dessen Stelle er ihm einen Stein in die Brust setzt. Peter ist nun erfolgreich, kann aber nicht mehr Anteil am Leben nehmen. Sein unerbittlicher Geiz bringt ihn in einer Aufwallung dazu, seine Frau Lisbeth zu erschlagen, als diese sich barmherzig erweist. Davon wachgerüttelt, fleht Peter das Glasmännlein an, ihm sein Herz zurückzugeben, was schließlich durch List gelingt. Das Glasmännlein erweckt Lisbeth wieder zum Leben. Peter kehrt zum Köhlerberuf zurück und erhält Anerkennung, ohne noch einmal reich zu werden.
Wilhelm Hauff wusste: Reichtum macht längst nicht jeden zum Philantropen, eher schon – bei naheliegendem, aber falschen Umgang – zum Misanthropen. Was er nicht wissen konnte, war, dass der Geist der Herzlosigkeit 200 Jahre später in Florida sein Unwesen treiben würde. Und dass es in Toronto einen Peter Munk gab, der sich rechtzeitig mit dem Glasmännlein anfreundete, so dass er nicht in die Schlingen des bösen Geistes geriet, sein Herz behielt und trotzdem vermögend wurde.
Europas Lehre: Pragmatik und Verantwortung
Die romantische Erzählung Wilhelm Hauffs taugt nicht als Lehrstück im historischen Sinn. Aber warum sollte ein literarisches Meisterwerk, das die Zeiten überdauert hat, nicht als überzeitliches Lehrstück gelesen werden können? Gute Literatur hat mit Gesellschaft zu tun. Und sehr gute Literatur kann Geschichte schreiben. Das scheint beim kalten Herz in einem geradezu unheimlichen Sinn der Fall zu sein: Während sich die aktuellen Regenten der USA benehmen, als hätten sie ihr Herz in Einmachgläsern verstaut, die in der Tiefe ihrer Banktresore lagern, lohnt der Blick auf jenen Kaufmann mit Herz, der vor 15 Jahren jenseits der Grenze sein Portemonnaie zückte, um sich für den Schutz vor Verfolgung zu bedanken. Ein Gegenbild, das Reichtum und Verantwortung zusammendenkt. Und nicht nur das. Auch Solidarität und Nutzen passen auf einmal zusammen, denn natürlich profitiert Kanada vom US-amerikanischen Brain Drain. Aber eben nicht schranken- und gewissenlos. Die Munk School handelt nicht aus Gier, sondern mit Bedacht. Das wissen die neuen Verfolgten, die sich die Entscheidung nicht leicht machten, offenbar zu schätzen.
Europa sollte sich ein Beispiel an dem ausgewanderten Peter Munk nehmen, der seinen Schatzhauser im Ahornwald fand: Offenbar gibt es gute Geister nicht nur dort, wo grüne Tannen stehen. Die Kunst ist, sie zu finden und bei ihnen auf Gehör zu stoßen. Es mag sein, dass das nur Sonntagskindern vergönnt ist. Aber wir alle, auch die nicht vom Sonntagsglück Beschenkten, sollten pfleglich mit den Ressourcen umgehen, die das Glasmännlein bereitstellt. Es spricht zwar nicht mit jedem von uns, doch verdient es den Vorzug vor dem bösen Michel. Der spricht mit allen – aber nur, damit sie ihm auf den Leim gehen. Und hat er genug Herzen eingesammelt, macht er sich ans Einsammeln der Hirne – was die Sache nicht besser macht.
Mit Herz und Hirn, so sollte die internationale Gemeinschaft auf den US-amerikanischen Brain Drain reagieren. Und nicht nur auf diesen, auch auf den aus Afrika, Asien, Russland etc….