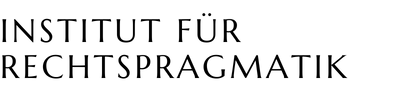Der Umgang vieler Medien mit Verlauf und Ergebnissen der US-Wahl bietet Anlass zur Sorge. Bestimmt habe ich nicht alle Sendungen gesehen oder Texte gelesen, die zu dem Thema ausgestrahlt oder verfasst wurden. Aber das, worauf ich gestoßen bin, hat mit journalistischem Handwerk wenig zu tun. Ich vermisse das redliche Bemühen, die eingetretene politische Lage sachlich zu beschreiben und, darauf aufbauend, die Aussichten einzuschätzen, vor denen Deutschland und Europa jetzt stehen. Und ich frage mich: Woher kommt das?
Beginnen wir mit dem Ausgangspunkt.
Verblüffung über funktionierende US-Wahl
Dem 5. November 2024 hatte die Welt entgegengefiebert. Alle blickten auf die US-Wahlen, hofften, bangten. Anders als von den meisten erwartet, konnte der Sieger noch am Wahltag ermittelt werden. Von Experten gehegte Befürchtungen, der zu erwartende knappe Wahlausgang werde die aufgeheizte politische Stimmung anfeuern, bewahrheiteten sich nicht. Ein zweiter US-amerikanischer Bürgerkrieg blieb aus. Nicht einmal eine Hängepartie bis zur Anerkennung des Wahlergebnisses gab es. Im Vorfeld geschriebene Bücher zu kontingenten Demokratien dürften nun erst einmal Ladenhüter werden. Zahllose Debatten um die Unregierbarkeit moderner Demokratien im allgemeinen und der USA im besonderen sind obsolet geworden – sollten wir sie vergessen? Nein.
Wir sollten einen Moment bei unserer Verblüffung innehalten – um anzuerkennen, dass das US-amerikanische Wahlvolk und das US-amerikanische Wahlsystem ihre Funktionalität unter Beweis gestellt haben. In diesem Punkt ist Joe Biden Recht zu geben: Die älteste noch ‚amtierende‘ Demokratie der Welt hat geliefert. Man kann sich fragen, woran das liegt – ob die Mehrheit in den Swing States von einer ‚Stimme der Vernunft‘ geleitet war, mit der sie dem Impuls folgte, eine Krise der Institutionen zu verhindern. Oder ob sie Ressentiments erlegen ist, die Ausdruck einer substanziellen Krise der US-Demokratie sind. Nur eines sollte man nicht tun: Die Mehrheit eines Wahlvolks für dumm und unmündig erklären, solange es dafür keine Beweise gibt. Und die demokratisch gewählte Regierung eines Landes für unberechenbar. Genau das geschieht leider gerade in deutschen Medien. Pauschal. Ohne Beweis. Wie kann das sein?
Reaktion Apokalypse
In einem Kommentar, der am 6.11.24 in der Tagesschau erschienen ist, hieß es:
„Den eigenen Leuten verspricht Trump goldene Zeiten, Deutschland und Europa droht die nächste Krise. Trump will Zölle auf europäische Produkte erhöhen, und er will noch vor Amtsantritt den Krieg gegen die Ukraine beenden – mutmaßlich [Herv. d. mich] zugunsten von Wladimir Putin.
Das fühlt sich am heutigen Tag apokalyptisch [Herv. d. mich] an. Aber es ist die Realität. Jedenfalls die Realität, die sich die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner wünscht.“
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-wahl-trump-kommentar-sie-wollen-es-so-100.html
Der Ausdruck „apokalyptisch“ ist im Zusammenhang mit der Einschätzung einer politischen – nicht militärischen – Lage fehl am Platz. Wer apokalyptische Eingebungen hat, gehört ins religionswissenschaftliche Lager oder sollte Science-Fiction-Autor werden. Aufgabe von Journalisten ist es, eine Sachlage so nüchtern und fair wie möglich zu beschreiben, um anschließend plausible Schlüsse daraus ziehen zu können. Eben daran hapert es hier: Eine faktenbasierte Grundlage dafür, dem neu gewählten US-Präsidenten zu unterstellen, er wolle den Ukrainekrieg zugunsten von Putin beenden, ist nicht erkennbar, nicht einmal andeutungsweise. Dem Kommentator ist bei seiner Aussage offenbar selbst nicht wohl, weshalb er seine Aussage mit einem „mutmaßlich“ relativiert. Semantik und Struktur des Satzes werden dadurch nur noch verworrener. Als ob es um die Beschreibung eines Verdachts ginge und nicht um eine politische Haltung!
Wir müssen uns fragen, woher es kommt, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland derart abgründige, unerklärte Thesen verbreitet werden. Liegt es daran, dass mit einem Widerspruch durch journalistische Gremien nicht zu rechnen ist? Sind die Erwartungen an das, was Journalisten leisten sollten, so tief gesunken, dass es am Bewusstsein für das Handwerkszeug fehlt? Beide Aspekte mögen eine Rolle spielen. Doch dürften die Ursachen tiefer liegen. Meine Vermutung ist, dass es in der deutschen Medienlandschaft Thesen gibt, die sich wechselseitig stabilisieren, obwohl – bzw. weil – ihnen nicht tragfähige Argumente, sondern beschwörende Rituale zugrunde liegen.
Ein weiteres Beispiel dafür bietet die ZEIT vom 8.11.24. Dort heißt es zum gleichen Thema, der neue US-Präsident sei „das Beste, was Putin passieren konnte“. Die russische Führung freue sich auf den Machtwechsel, weil der neue US-Präsident Putin „nicht nur im Ukrainekrieg …, sondern auch bei der Spaltung Europas“ behilflich sein dürfte.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2024-11/donald-trump-sieg-russland-wladimir-putin-ukraine
Auch hier eine steile These, die nicht hergeleitet wird, sich aber umso besser dazu eignet, Emotionen zu beschwören. Geht es darum, die Leser am emotionalen Gängelband zu halten, damit sie nicht auf den Gedanken kommen, argumentative Hilfestellungen für ernsthafte Diskussionen einzufordern?
Oder gibt es womöglich nichts mehr zu diskutieren, weil die Entscheidungen, die mit dem neuen US-Präsidenten drohen, so irrational sind, dass wir darauf nur mit kruden Ängsten reagieren können? Ich vermute das Gegenteil: Der neu gewählte US-Präsident ist bei weitem nicht so unberechenbar, wie er medial beschrieben wird. Die Emotionalisierung lenkt davon ab, dass es nicht nur plausible Prognosen über das gibt, was die USA in den nächsten vier Jahren tun werden und was nicht. Es gibt auch einen Auftrag an die deutsche und europäische Politik wie sie sich dazu verhalten sollte. Die Fokussierung auf eine dämonisierte Person erfüllt einen anderen Zweck: Sie hält vom Denken ab.
Was trägt Europa? Zurück zum Kern
Nehmen wir nochmals den Ukrainekrieg als Beispiel für die zu erwartende Art und Weise, wie die USA Politikfelder in den nächsten vier Jahren bearbeiten werden. Der neue US-Präsident ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war zuvor bereits vier Jahre im Amt. Seine Außenpolitik aus der ersten Regierungszeit lässt sich auf einen Begriff bringen: Isolationistischer Reputationismus. Präsident T – sein Name soll hier abgekürzt werden, weil es um die leitenden Handlungsmaximen geht, nicht um die Person – hat kein politisches Programm und keine konkrete Agenda, er ist das Programm. Und er zieht je nach Bedarf eine neue Agenda aus dem Ärmel. Dafür steht der Slogan MAGA: Der neue US-Präsident will die USA wieder zu alter Größe führen, indem er Freiräume für die Eroberer des Landes schafft, die es wie früher ausbeuten wollen. Ungestört von ‚Fremden‘. Für diese Leitidee schließt T am liebsten Verträge ab. Zum einen, weil er glaubt, das am besten zu können – er betrachtet sich als gewieften und erfolgreichen Geschäftsmann. Zum anderen, weil er mit seinen Deals glaubt, etwas für seine Reputation beim US-amerikanischen Wahlvolk tun zu können. Wenn T sagt, er könne den Ukrainekrieg in 24 Stunden beenden, bedeutet das genau dies: Er hat einen Vorschlag für einen Deal, von dem er denkt, dass er ein gutes Geschäft wäre, am meisten für ihn selbst. Nicht mehr und nicht weniger.
Wir müssen nicht weiter ins Detail über die politische Programmatik oder Nicht-Programmatik der neu gewählten US-Regierung gehen. Auch ohne Psychologie studiert oder sich intensiv mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt zu haben, kann man anhand der beschriebenen Tatsachen schlussfolgern: Weder Kiew noch Moskau werden es mit T leicht haben. Er wird niemandem etwas schenken, auch Putin nicht. Die Situationen, die sich einstellen können, sind zahlreich. Sie liegen aber nicht jenseits des Prognostizierbaren. Um es mit den Worten des ehemaligen US-amerikanischen Außenministers Rumsfeld auszudrücken: Es handelt sich um known unknowns: Allgemein gesprochen, wird T diejenige Konfliktpartei, die sich aus seiner Sicht am weitesten in die Richtung eines ihm genehmen Deals bewegt, protegieren. Allerdings nie vorbehaltlos und dauerhaft. Welche der beiden Seiten kann es sich aber leisten, in die Richtung zu schwenken, die T – voraussichtlich oder vorübergehend – genehm wäre? Die Stabilität der ukrainischen Regierung könnte ins Wanken geraten, wenn sie anfinge, über Abtretungen von Teilen des eigenen Territoriums zu verhandeln. Auf russischer Seite besteht das Risiko, dass die Unterstützung der regimetreuen Bevölkerung kippen könnte, wenn die Erzählung vom faschistischen Staat, den man erobern müsse, mir nichts dir nichts durch eine andere ersetzt würde. Die irrsinnig hohen russischen Opferzahlen erschweren den Rückweg in ein diplomatisch gangbares Fahrwasser. Daran sieht man: Die Hürden sind gewaltig.
Was also ist in näherer Zeit zu erwarten? Zuzutrauen ist T, dass es ihm gelingt, Bewegung in festgefahrene politische Situationen, auch kriegerischer Art, zu bringen. Es wäre ein großer Erfolg, wenn es ihm gelänge, einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeizuführen. Schon das ist aber unwahrscheinlich, da Putins Kalkül entweder in nächster Zeit aufgeht – wenn der Westen sich auseinanderdividieren lässt – oder gar nicht. Putin wird aus diesem Grund momentan nicht verhandeln wollen, die Ukraine vermutlich in einem Jahr nicht mehr. Das bedeutet unterm Strich: Wenn Ts Strategie eines schnellen Deals mit maximaler Reputationsförderung aufgehen sollte, würde auch die Ukraine profitieren, weil das russische Angriffsmomentum wegfiele. Zu einem Deal gehören aber immer mehrere. Jeder kann Nein sagen, auch die Ukraine.
Und was wäre im Fall eines Deals aus europäischer Sicht zu befürchten? Gar nichts. Gelingt es T, einen Waffenstillstand herbeizuführen, kann sich Europa – trotz Differenzen in sachpolitischen Fragen – hinter den US-Präsidenten stellen. Gelingt es nicht, wird T ein weiteres Mal in den Augen der Welt als ein Mann großer, nicht eingehaltener Versprechen dastehen. Eine Schwächung Europas wäre damit nicht verbunden.
Das Beispiel zeigt: Der schreckhafte Blick auf die angeblich unberechenbare neue US-Politik lenkt von der eigenen Starre bzw. politischen Perspektivlosigkeit ab. T ist nicht das Übel für Deutschland, das einige Medien beschwören, sondern die Tatsache, dass Politik und Gesellschaft hierzulande es versäumen, die Epochenwende auszubuchstabieren, die mit dem russischen Zivilisationsbruch durch den Angriff auf die Ukraine entstanden ist.
Folgerungen: Europas To do-Liste
Was also ist zu tun? Die Forderung, Europa möge zusammenhalten, ist zu abstrakt und läuft ins Leere. Die Agenda muss konkreter sein, um Europa als Kulturkreis und Demokratiestandort zu stärken und für Leistungsträger weltweit begehrlich zu machen, die Schutz vor autoritären Regimen suchen. Das beste, was Europa tun kann, ist, einen attraktiven demokratischen Gegenraum zum grassierenden Autoritarismus zu schaffen. Dazu gehören die folgenden Punkte:
1. Die Dämonisierung von Personen ist zu beenden.
Die Strategie der Dämonisierung besteht darin, einen irrationalen, auf Angst gegründeten Abwehrreflex auszubilden. Eine solche Strategie verfängt heutzutage allenfalls kurzfristig. Sie schlägt ins Gegenteil um, sobald das angesprochene Publikum davon überzeugt ist, dass der Dämon in Wahrheit ein Popanz ist.
Beim neu gewählten US-Präsidenten lässt sich das gut beobachten: Er zieht seine Stärke aus der Überzeugung seiner Anhänger, ihm werde Unrecht getan. Europäische Politiker machen in Bezug auf autoritäre Bewegungen den gleichen Fehler: Sie werten Personen auf, die sie verteufeln, anstatt engagiert, aber akkurat in der Sache für einen demokratischen Gegenraum einzutreten.
2. Die demokratische Programmatik Europas ist neu zu bestimmen.
Langfristig ist ein demokratisch fundiertes Sachprogramm dem Modell des Personenkults, wie T es praktiziert, überlegen. Das gilt aber nur, wenn es gelingt, eine glaubwürdige, nationenübergreifende Programmatik aufzustellen, in der sich die Anhänger der liberalen Moderne ebenso wiederfinden wie europäische Traditionalisten.
Mit der Frage, wie das praktisch funktionieren kann, müssen wir uns stärker als bislang beschäftigen. Dazu – nicht abschließend – die Thesen 3-5:
3. Eine demokratische Diskussionskultur ist vorzuleben und einzuüben.
Um gemeinsame Grundlagen und Werte aufzufinden und festzuhalten, dürfen die Teilnehmer an Diskussionen nicht in Mitstreiter und Gegner eingeteilt werden. Wer überstimmt wird, ist deshalb nicht im Unrecht. Dissens darf nicht verteufelt werden, schon gar nicht, wenn es um grundlegende Überzeugungen geht. Hinhören, Gemeinsamkeiten suchen, Unterschiede ausloten. Das muss der Weg sein. Dagegen sind mediale Empörungsspiralen, die belastbare Argumente ausschalten, Gift für eine demokratische Diskussionskultur.
So gehört der Hinweis darauf, dass Klimamodelle an der Beschreibung realer Klimaphänomene scheitern, in kein politisches Lager. Wird dieser Hinweis von jemandem gegeben, der einem extremen politischen Lager angehört, ändert dies nichts an der Qualität des Arguments. Die Gleichsetzung zwischen politischer oder persönlicher Sympathie und Validität eines Arguments ist ein demokratiegefährdender Trugschluss.
4. Mehr Empirie
Wer eine Hypothese aufstellt, erkennt die Empirie als Richterin an. Wer dagegen auf Fakten pocht, spielt selbst Richter. Eine Diskussion ist in dem behaupteten Punkt dann nur noch sehr eingeschränkt möglich, falls überhaupt. Wer den Diskussionsraum offen halten will, muss deshalb der Empirie so weit wie möglich den Vorzug lassen. Man kann hierbei von einer argumentativen Gewaltenteilung sprechen: Die Diskutanten gehen von einer gemeinsamen Ausgangsbasis, der Prämisse, aus, argumentieren dann im Rahmen von Hypothese und Gegenhypothese, während die empirische Evidenz entscheidet. Die Prämissen sind der Diskussion vorgeschaltet, die Evidenz ist ihr nachgelagert.
Es ist daher eine gefährliche Verengung, wenn in der öffentlichen Debatte Aussagen, wie es allzu oft geschieht, in Fakten oder Meinungen eingeteilt werden. Der Vorwurf von „Fake News“ steht permanent im Raum und untergräbt den inhaltlichen Austausch. Das weite Land zwischen „wahr“ und „falsch“ kann damit nicht mehr auf eine Weise erkundet werden, die Rückzugsmöglichkeiten offenlässt. Diese sind aber entscheidend, damit Gesprächspartner das Gesicht wahren können.
5. Die neue Programmatik ist auf einen pragmatischen Ansatz zu gründen.
Autoritäre Tendenzen und eine Fixierung auf Personen statt Programmatiken sind auf dem Vormarsch – auch in Europa. Sie sind nicht nur Folge der oben beschriebenen Phänomene (Dämonisierung, Verstoß gegen die argumentative Gewaltenteilung), sondern auch Ausdruck des Versagens der alten Programmatik.
In Deutschland und Europa haben sich Begriffe abgelebt, Regelwerke sind in Alltag und Beruf allgegenwärtig und kaum noch zu überblicken, geschweige denn zu bewältigen. Bei einer neuen Programmatik darf es sich deshalb nicht um eine weitere Begrifflichkeit handeln, die zu den vielen alten Regelwerken wie ein weiterer Schaltkreis hinzukommt. Es muss vielmehr Teil der neuen Programmatik sein, Regeln von ihrem Gebrauchswert her zu denken und zu erlassen.
Der versteckte Regelfundamentalismus, der in Europa grassiert, kann nur mit einem pragmatischen Ansatz überwunden werden. Darüber, wie dieser konzipiert und umgesetzt werden kann, sollten wir nachdenken, bevor es zu spät ist.
Wenn wir scheitern, liegt es an uns – nicht an autoritärem Personal, mag dessen Name nun mit T beginnen oder mit M, mit H, O oder L.