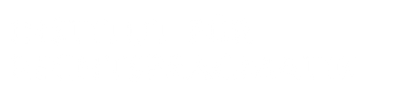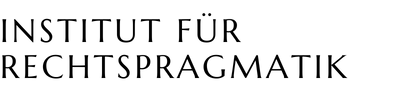Teil 1: Interview mit RA Markus Nessler
In einem mit dem Institut für Rechtspragmatik (IfR) am 29.1.2025 geführten Interview äußerte sich Rechtsanwalt Markus Nessler MBA, Experte für Wettbewerbs- und Kartellrecht, zu den Anforderungen an gute Rechtsberatung in der Unternehmenspraxis.
Das Gespräch ist Teil 1 einer Interview- und Analyse-Reihe des IfR über die Rolle anwaltlicher Experten als Helfer bei der Routinenbildung.
Hintergrund der Gesprächsreihe ist die Annahme, dass Routineprozesse für das Funktionieren komplexer Gesellschaften zwar von zentraler Bedeutung sind, aber noch zu wenig verstanden werden. Anhand der Befragung von Experten widmet sich die Reihe u.a. den folgenden Fragestellungen: Welche Bedeutung kommt Routinen in arbeitsteilig ablaufenden Produktions- und Wertschöpfungsprozessen zu? Wie lassen sich gute von schlechten Routinen unterscheiden? Welche Rolle spielen Experten bei der Überwindung überholter oder schlecht eingespielter Routinen? Wie lassen sich Routinen neu begründen?
Der Fokus der Gesprächsreihe wurde auf Experten auf dem Gebiet der Rechtsanwendung beschränkt. Die Gespräche werden als Interview geführt, um die Erfahrung der interviewten Experten möglichst maßstabsgetreu zum Ausdruck zu bringen.
Die Gesprächsreihe ist noch nicht abgeschlossen. Da die Analysen der Interviews sich wechselseitig stützen, haben die vorgestellten Ergebnisse bis zum Abschluss der Interview-Reihe vorläufigen Charakter. Bereits jetzt kann aber festgestellt werden, dass Auftraggeber bei der Vertretung ihrer Interessen umso bessere Ergebnisse erwarten können, je mehr sie darauf achten, dass die von ihnen beauftragten Experten die in den Ergebnissen beschriebenen Kriterien und Prozesse einhalten.
Eine ausführliche Zusammenfassung der Analyse von Teil 1 kann angefordert werden unter info@institut-für-rechtspragmatik.com.
Das vollständige Interview ist hier einsehbar.
– Auszug aus der Analyse –
Vorwort
Für die längste Zeit in der menschlichen Entwicklung waren Experten – Personen mit Sonderwissen, das sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen – hilfreich, in Alltagsbelangen aber verzichtbar: Gesellschaften, die mit Hilfe von Experten über Techniken verfügten, Krankheiten effizient zu heilen, landwirtschaftliche Erträge zu verbessern, Transportwege zu sichern oder Kommunikationszeiten zu verkürzen, hatten einen Standortvorteil. Aber der Alltag wurde nicht von Experten geprägt. Das ist heute anders. Inzwischen sind Experten auch im Alltag unverzichtbar geworden. Dafür zwei Beispiele: Wer einer digital geprägten Tätigkeit nachgeht, ohne auf einen IT-Experten zurückgreifen zu können, macht seine Arbeitsleistung vom Zufall abhängig. Wer Haus oder Wohnung hat, muss, spätestens wenn Renovierungen anstehen, Expertise für Energiesparmaßnahmen einholen. Selbst die Frage, wie man unterwegs sein und wo man einkaufen sollte, erscheint uns als kaum noch beantwortbar, wenn wir nicht Experten hinzuziehen. Einiges davon mag übertrieben sein. Vieles ist aber nicht nur Ausdruck eines umfassend gewordenen Verantwortungsbewusstseins, sondern auch Resultat technischer Entwicklungen, die immer weiter in die Privatsphäre hineinragen, was zu steigenden Abstimmungs- und Regelungsbedarfen führt.
Die Ubiquität des Bedarfs an Experten ist neu. Problematisch daran ist, dass moderne Gesellschaften im Umgang mit Experten nicht geschult sind. Über Jahrhunderte waren Experten Respektspersonen, denen aufgrund ihrer Funktion ein herausgehobener Status zukam, sei es als Heiler, Berater oder Beschwörer. Die Auswahl von Experten war ein für das Gemeinwesen bedeutsamer Akt, der oft mit Ritualen begleitet war und inszeniert wurde. Demgegenüber ernennen sich Experten in liberalen Gesellschaften selbst oder unterliegen einem Auswahlverfahren, das sich nach dem Motto „Ein gutes Pferd springt so hoch wie es muss“ bewältigen lässt. Die Zulassung zur Berufsausübung verbürgt damit weder den Qualitätsanspruch noch die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, die mit dem Einsatz von Sonderwissen einhergehen müssen, um die Interessen von Auftraggebern adäquat zum Ausdruck zu bringen. Wie aber lässt sich in liberalen Gesellschaften ein gemeinwohlorientierter und damit friedensstiftender Einsatz von Sonderwissen sicherstellen? Das von Experten verwaltete Sonderwissen verleitet Außenstehende teils zu übergroßem Respekt – wenn sie traditionell-statusorientiert denken – , teils zu abwertenden Generalisierungen – wenn sie empirisch-leistungsorientiert vorgehen. Letzteres mag ein kritischer Reflex gegen den herausgehobenen Status sein, der Experten besonders im Bereich der menschlichen Gesundheit lange zukam („Halbgötter in Weiß“), ersteres eine unkritische Übernahme tradierter Muster, in denen der Kontakt zu Experten als außeralltäglich angesehen wurde. Beide Verhaltensmuster sind noch verbreitet, obschon der Sache nach obsolet.
Welchen Umgang sollten wir aber mit Experten pflegen, um deren Potenzial auszuschöpfen? Die These dieser Interview-Reihe lautet: Die Rolle und Bedeutung von Experten in modernen Gesellschaften liegt darin, Helfer bei der Routinebildung zu sein. Ob und unter welchen Voraussetzungen dies gelingt, soll mit der Interview-Reihe am Beispiel der Rechtsanwendung aufgezeigt werden.
Die Bedeutung der Ausbildung, Überprüfung und Einübung von Routinen wird häufig unterschätzt. Bei Routineprozessen handelt es sich, wie zu zeigen sein wird, um einen Angelpunkt für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung komplexer Gesellschaften, die auf eine funktionierende Gewaltenteilung setzen. Trifft diese These zu, versteht es sich, dass dem Handeln von Personen, die Einfluss auf Routinen nehmen, indem sie ihre besondere Sachkunde für die Entfaltung der ihnen zugrundeliegenden Prozesse einsetzen, eine besondere Bedeutung zukommt. Von Experten hängt viel ab.
Eine umfassende Theorie des Expertentums wird mit der vorliegenden Interview-Reihe nicht angestrebt. Auftraggeberin der Studie ist das Institut für Rechtspragmatik. Darum wurde die Auswahl der Experten auf das Gebiet der Rechtsanwendung beschränkt. Der Fokus ist damit zwar begrenzt, verspricht aber umso deutlichere Erkenntnisse. Denn nicht jeder Prozess der Expertisierung muss notwendig in allen gesellschaftlichen Bereichen gleich ablaufen. Charakteristisch für die Rechtsanwendung ist die Figur des Dritten, vor dem eine Rechtfertigung stattfinden muss – beim Richter die Idee des Souveräns, in dessen Namen Urteile ergehen; in der Verwaltung ist dagegen die Binnenlogik der Zielerreichung vorherrschend, gegenüber der private Interessen als Fremdkörper auftreten, vor denen eine Legitimierung erfolgen muss; in der Advokatur ist die Allgemeinwohlorientierung umgekehrt ein Korrektiv, das von außen die Klientenerwartung begrenzt. Die Rolle von Experten in diesen unterschiedlichen Anwendungsfeldern verspricht Aufschlüsse für eine Theorie und Didaktik der Rechtspragmatik. Die Engführung ist daher gewollt.
Warum Interviews? Man kann über Experten sprechen. Oder sie zum Sprechen bringen. Im ersten Fall wird eine Meinung verbreitet, im zweiten eine Haltung aufgezeigt. Um den zweiten Fall geht es hier, da sich in der Haltung eine Form der Praxis verkörpert, die – anders als bei bloß assertorisch hingenommenen Behauptungen – nicht hintergehbar ist. Allerdings können Praktiken mehr oder weniger deutlich sichtbar sein. Manchmal versteckt sich hinter einer vorgetragenen Praxis eine zweite, womöglich gegenläufige. Um zu einer validen Analyse der sozialen Praxis zu gelangen, kommt daher der Beobachtungsmethode eine herausragende Bedeutung zu. Für die Analyse von Gesprächsprotokollen steht mit der strukturalen Hermeneutik ein Analyseinstrument zur Verfügung, das Kontrollen und unterschiedliche Tiefenschärfen erlaubt (www.agoh.de). Ausgehend von einem sprachpragmatischen Untersuchungsansatz, dem die Erfahrung einer geteilten Sprachgemeinschaft zugrunde liegt, lassen sich unterschiedliche Interpretationshypothesen aufstellen, die solange überprüfbar bleiben, wie das Sprachprotokoll besteht, auf dem sie beruhen. Die Wiedergabe dieses Ansatzes erfolgt hier in verkürzter Form, um die Hypothesen nachvollziehbar zu beschreiben, ohne dass die Lesbarkeit beeinträchtigt ist. Gesprochene und analysierte Textstellen wechseln sich ab.
Zusammenfassung der Ergebnisse
1. Rechtsanwälten kommt als Experten für die Vermittlung von privaten und Gemeinwohl-Interessen eine gesteigerte Verantwortung zu, da sie über einen Wissensvorsprung verfügen, der für ihre Mandanten riskant ist. Setzen sie die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente falsch ein, droht ein Schaden, der im Extremfall existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann. Daher ist es wichtig zu wissen, wie ein anwaltlicher Experte, ähnlich einem guten Arzt, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel sachgerecht einsetzt – und woran man dies erkennt.
2. Anwaltliche Experten erarbeiten sich das Vertrauen ihrer Mandanten dynamisch über eine dialogische Schrittfolge: Ausgehend von einem rezeptiven Situationsverstehen, stellen sie fortwährend Hypothesen auf, um das Problem zu verstehen, das ihrer Beauftragung zugrunde liegt. Die sich verdichtenden Hypothesen setzen sie ein, um im Wechsel von Erklären und Revidieren gemeinsam mit den Mandanten eine effektive Problemlösung zu finden. Damit konkretisiert sich nach und nach das ihnen entgegengebrachte Vertrauen, das zunächst abstrakt ist, manchmal auch ambivalent.
3. Problemverstehen und empathisches Verstehen sind für eine kompetente Problembearbeitung durch anwaltliche Experten gleichermaßen wichtig, dürfen aber nicht gleichgesetzt werden. Während das empathische Verstehen spontan auf lebensweltlicher Grundlage erfolgt, wird das Problemverstehen, dem Wissen und Erfahrung zugrunde liegen, vom anwaltlichen Experten methodisch eingesetzt. Auf dieser Grundlage entsteht beim Klienten der doppelte Eindruck, als Person verstanden zu werden und kompetente Hilfe zu erhalten. Beides zusammen bewirkt, dass der Mandant sich in guten Händen weiß.
4. Anwaltliche Experten können eine Schlüsselstellung bei der Ausbildung neuer Routinen einnehmen, indem sie ihren Mandanten bei der Realitätsprüfung im Umgang mit deren legitimen Interessen behilflich sind. Dies beginnt mit einem Abgleich zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Kommt es dabei zu Widersprüchen, wirken sie darauf hin, die dahinter liegenden Einstellungen aufzubrechen. Ist der Mandant ein Unternehmen, geht es ihnen darum, dass Mitarbeiter und Unternehmensleitung einander verstehen und auf der Basis eines geteilten Verständnisses handeln. Leitend ist dabei nicht die Vorstellung, widerspruchsfreie Aussagen zu erzeugen, sondern kontraproduktive Routinen aufzubrechen.
5. Anwaltliche Experten, die sich als Helfer bei der Ausbildung neuer Routinen verstehen, kombinieren die handwerkliche Rechtsberatung mit der Unternehmensberatung, ohne zu Unternehmensberatern zu werden. Von letzteren unterscheidet sie, dass sie von einem normativ geprägten Soll-Zustand ausgehen – aus standesrechtlichen und haftungsrechtlichen Gründen. Im Fall der Begleitung von Unternehmen geht ihrer Kritik an schlechten Routinen das Wohin der Ausbildung guter Routinen voraus: Geschäftsleitung und Mitarbeiter sollen sich für den Erfolg des Unternehmens (mit-)verantwortlich einsetzen. Beispielsweise macht die Ausarbeitung von Vertriebsverträgen wenig Sinn, wenn deren Umsetzung keine Vertriebsstrategie zugrunde liegt, die von allen geteilt wird. Ein guter anwaltlicher Experte versteht sich als Helfer bei der Ausarbeitung einer passenden Strategie. Er wirkt an der dazu erforderlichen Prämissenbildung mit.
6. Ist eine passende Vertriebsstrategie aufgestellt, helfen anwaltliche Experten bei der Überwindung von Widerständen gegen die Ausbildung neuer Routinen, die für eine Umsetzung der Strategie erforderlich sind. Hierzu transformieren sie als diffus empfundene Gefahren, die in neuen Praktiken liegen können, in abwägungsfeste Risiken, die gegen Einwände im Vollzug der neuen Strategie rational behauptet werden können. Auch robuste Vorgehensweisen sind möglich, sobald die Spielregeln verstanden sind und eingehalten werden. So würde ein anwaltlicher Experte kein Mandat übernehmen, mit dem ihm ein Unternehmen anträgt, den Preisdruck aus dem Online-Handel mit illegalen Mitteln herauszunehmen. Geht es dagegen um verbesserte Warenverteilung und Beratungskompetenz, wird er sich beauftragen lassen, eine adäquate Umsetzung der Strategie im Rahmen der Ausbildung entsprechender Routinen zu begleiten.
7. Anwaltliche Experten im hier beschriebenen Sinn zeichnen sich nicht allein über Titel und Sachkunde aus. Sie bringen zusätzlich die Kompetenz für das Verständnis sozialer Praktiken und die Bedeutung des Dialogs mit. Auf diese Weise sind sie fachlich und situativ in der Lage, auf die Abschaffung kontraproduktiver und die Ausbildung neuer, effektiver Routinen hinzuwirken.
8. Anwaltliche Experten im hier beschriebenen Sinn kommunizieren bei der Umsetzung des mit dem Mandanten erstellten Lösungsansatzes mit Vertretern des Gemeinwohls (insbesondere mit Entscheidern aus Verwaltung und Justiz), um private Mandanteninteressen und Gemeinwohlorientierung vermittelnd ab- und auszugleichen. Auf diese Weise lassen sich Wege abkürzen und Ressourcen sparen. Beides ist für mittelständische Unternehmen von Bedeutung, die typischerweise nicht über derart große Markt- oder Lobby-Macht verfügen, dass sie Spielregeln kontinuierlich hinterfragen oder umgestalten lassen können.