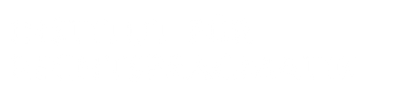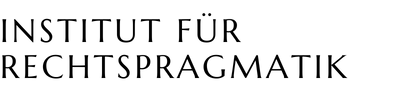Am 2.07.2025 traf ein Richter am Amtsgericht Köln eine familienrechtliche Entscheidung zum Umgangsrecht. Es handelte sich um eine Routinesache. Der schriftlichen Begründung des Beschlusses merkt man an, dass der Richter kein Anfänger war. Er begründete die Entscheidung rechtlich fundiert, wog seine Argumente sorgfältig ab und formulierte so klar, dass Prozessbeteiligte den Maßstab, der angelegt wurde, gut nachvollziehen konnten. Als neutraler Dritter hat man bei der Lektüre den Eindruck: Diese Entscheidung hat das Zeug, wenn nicht zum familiären Frieden, so doch wenigstens zum Rechtsfrieden beizutragen. Hat der Richter also alles richtig gemacht?
Geht es nach Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, einem Experten für anwaltliches Berufsrecht, ist das nicht der Fall. In einem Kommentar für die Legal Tribune Online meint Römermann, der Richter habe in dieser Sache einen Faux pas begangen. Römermanns Kritik betrifft nicht die Fallentscheidung, sondern die Art und Weise ihres Zustandekommens. Es geschieht selten, dass in der Fachöffentlichkeit über eine solche Frage gestritten wird. Die nachfolgende Analyse soll ein Beitrag zu dieser Debatte sein. Denn die ist wichtig. Worin besteht die Kritik an der Kritik?
Zum Fall: Urteilsschelte als obiter dictum
Ausgangspunkt ist das prozessuale Verhalten des anwaltlichen Vertreters der Mutter. Diese war dem Antrag des Vaters, ein Wechselmodell im Umgang mit den beiden minderjährigen Kindern einzuführen, entgegengetreten. In seiner Argumentation referierte der Prozessbevollmächtigte, welche Auffassungen zu den Voraussetzungen des Wechselmodells vertreten werden. Offenbar griff er dabei unsachgemäß auf KI-Anwendungen zurück, denn der Richter monierte die Ausführungen des Anwalts, nachdem er zunächst die Rechtslage zum Wechselmodell wiedergegeben hatte, wie folgt:
„Die weiteren von dem Antragsgegnervertreter im Schriftsatz vom 30.06.2025 genannten Voraussetzungen stammen nicht aus der zitieren Entscheidung und sind offenbar mittels künstlicher Intelligenz generiert und frei erfunden [Hervorhebungen im Original, Anm. K-K]. Auch die genannten Fundstellen sind frei erfunden. Viefhues kommentiert nicht im Münchner Kommentar, sondern den juris PraxisKommentar BGB Band 4, dessen Herausgeber er ist. Die 9. Auflage stammt aus dem Jahr 2024, nicht 2021. § 1678 BGB wird von Hennemann kommentiert. § 1687 des jurisPK-BGB Band 4 wird nicht von Brömmelmeyer, sondern von Thormeyer kommentiert. Eine Randziffer 65 ff. gibt es in dem Kommentar nicht. Die Erläuterungen enden bei Rn. 36. Die Fundstelle Brons, Kindeswohl und Elternverantwortung, 2013, S. 175 ff. konnte seitens des Gerichts nicht gefunden werden. Eine Fundstelle Völkl, FamRB 2015, Bl. 74 ist ebenfalls frei erfunden. In der FamRB 2015 findet sich auf Bl. 70 – 77 der Aufsatz: Ist § 17 VersAusglG verfassungsgemäß? – Verfassungsrechtliche Überlegungen zur Kritik an dieser Vorschrift. Auch ein Werk „Meyer-Götz, in: Hauß/Gernhuber, Familienrecht, 6. Aufl. 2022, § 1671 Rn. 33“ gibt es nicht. Hier werden offenbar 3 verschiedene Werke vermengt. Den entsprechenden Rechtssatz, wonach ein Wechselmodel mit einem psychisch instabilen Elternteil grundsätzlich unvereinbar ist, gibt es nicht. Auch eine Fundstelle OLG Frankfurt, FamRZ 2021,70 ist frei erfunden. Auf Bl. 67-70 der FamRZ aus dem Jahre 2021 findet sich die Entscheidung des OLG Düsseldorf zur Thematik Zustimmungserfordernis der Ersatznacherben zur Löschung eines Nacherbenvermerks. Auf Bl. 70-70 findet sich die Entscheidung 1 W 1276 / 20 des Kammergerichts, die sich mit der Grundbuchberichtigung aufgrund von Teilerbscheinen auseinandersetzt.“
Römermann nennt es in seinem LTO-Kommentar „kein Ruhmesblatt, sondern Ausdruck schlampiger Arbeit, wenn ein Anwalt ungeprüft KI-Texte übernimmt, anstatt sich selbst der Mühe rechtlicher Auseinandersetzung zu unterziehen.“ Das ist zwar richtig, verkennt aber einen entscheidenden Punkt: Es handelt sich nicht nur um eine rechtliche Auseinandersetzung. Der Richter hatte einen Streit zwischen zwei Eltern zu entscheiden, die ihrer Elternrolle nicht gerecht wurden. Den darin liegenden sozialen Sprengstoff kann man anheizen oder auf professionelle Weise zu dessen Befriedung beitragen. Das richterliche Handeln ist als Versuch im Sinne der zweiten Option zu deuten. Denn der Richter hatte, wie es in solchen Fällen üblich ist, einen Verfahrensbeistand für die minderjährigen Kinder bestellt. Dieser war laut Sachverhaltsbeschreibung zu dem Ergebnis gekommen: „Die Eltern müssten dringend an ihrer Kommunikation arbeiten. Es sollte gemeinsam in der Verhandlung überlegt werden, welche Form der Beratung in Betracht komme, um die Kinder aus dem ‚Minenfeld der Elternkonflikte‘ zu befreien.“
Vor diesem Hintergrund ist die Kritik am Verhalten des Prozessbevollmächtigten der Mutter zu sehen, die der Richter in die Gründe seiner Fallentscheidung aufnimmt:
„Der Verfahrensbevollmächtige hat derartige Ausführungen für die Zukunft zu unterlassen, da sie die Rechtsfindung erschweren, den unkundigen Leser in die Irre führen und das Ansehen des Rechtsstaates und insbesondere der Anwaltschaft empfindlich schädigen. Er wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen Verstoß gegen § 43 a Abs. 3 BRAO handelt, wenn ein Rechtsanwalt bewusst Unwahrheiten verbreitet. Hierzu gehört der wissentlich falsche Vortrag über Inhalt und Aussagen von Gesetzen und Urteilen (Weyland/Bauckmann, 11. Aufl. 2024, BRAO § 43a Rn. 39; Henssler/Prütting/Henssler, 5. Aufl. 2019, BRAO § 43a Rn. 140). Der Verfahrensbevollmächtigte ist Fachanwalt für Familienrecht und sollte die Rechtslage kennen.“
Was der Richter mit seiner Kritik bezweckte
Der Richter begreift den anwaltlichen Prozessbevollmächtigten offenbar als Helfer in der Befriedung des sozialen Konflikts, der hinter dem rechtlichen Konflikt steht. Ein Anwalt, der Ersatznacherben ins Spiel bringt, wenn es um das Kindeswohl geht, erschwert in der Tat nicht nur die Rechtsfindung, sondern auch die Kommunikation über den zugrunde liegenden sozialen Konflikt. Das zu lösende Problem – die schlechte Elternkommunikation – tritt in den Hintergrund; man könnte sogar sagen, dass das reale Kommunikationsproblem in der Person des Prozessvertreters reinszeniert wird. Dies läuft seinem Auftrag zuwider, legitime Parteiinteressen wahrzunehmen, ohne in Freund-Feind-Schemata zu verfallen, mit denen unproduktive Handlungsmuster verstärkt werden. Man kann förmlich mit Händen greifen, wie der Richter die einschlägigen Vorschriften der Berufsordnung für Anwälte in der Erwartung oder Hoffnung durchgesehen haben muss, dort auf eine Norm zur anwaltlichen Mitarbeit am Rechtsfrieden zu stoßen. Fündig glaubte er in § 43 a Abs. 3 der Berufsordnung geworden zu sein. Dort steht: „(3) Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solche herabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben.“ Das passte zwar nicht 100%ig. Denn der Anwalt verletzte seinen Kooperationsauftrag nicht durch Manipulation der Tatsachen oder Beschimpfung der Gegenseite, sondern durch den nachlässigen Einsatz von KI. Die Grenzen sind allerdings fließend. Offenbar setzte der Richter auf die Schnittmenge: Wer als Anwalt die Rechtslage bewusst unzutreffend wiedergibt, verstößt gegen § 43 a Abs. 3 BRAO.
Was Römermann an der richterlichen Kritik kritisiert
Römermann kritisiert die richterliche Auslegung an dem Punkt, an dem das berühmte Brett am dünnsten ist: Dem Anwalt könne nicht nachgewiesen werden, dass er die Rechtslage bewusst falsch wiedergegeben habe. Das „simple Vertrauen auf plausible Zuarbeit“ durch die KI sei noch keine Lüge. Mit seiner Einschätzung erweist Römermann der Rechtspflege allerdings einen Bärendienst.
Es lässt sich pauschal gar nicht sagen, ob der Anwalt die Rechtslage bewusst oder aus bloßer Nachlässigkeit falsch wiedergab. Da es um den Einsatz von KI geht – genau genommen auch nur um den Verdacht des KI-Einsatzes – , müsste man, um die Frage entscheiden zu können, wissen, welche(n) Prompt(s) eingegeben wurden. Ein Prompt wie „Erstelle einen anwaltlichen Schriftsatz in einem Rechtsstreit ums Umgangsrecht, wobei Du zugunsten der Mutter argumentierst, die gegen das Wechselmodell ist, weil der Vater ein unzuverlässiger Schurke ist“ wäre anders zu beurteilen als ein Prompt im Sinne von „Gib aus anwaltlicher Sicht unter Angabe der Quellen die Rechtslage zum Wechselmodell in einem Rechtsstreit ums Umgangsrecht wieder“.
Was an Römermanns Kritik zu kritisieren ist
Wenn es aber auf Indizien für die Perspektive des KI-Anwenders ankommt, stehen wir vor einem neuen Problem, das gleichzeitig ein altes ist: Wie soll man einen Indizienprozess führen? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Verrechtlichung oder die – in diesem Fall deontologische – Einhegung. Letzteres wäre das Wünschenswertere. Es ist der Weg, den der Richter am Amtsgericht Köln vorgeschlagen hat. Anders als Römermann meint, hat der Richter gerade nicht versucht, dem Anwalt eine Weisung zu erteilen. Dies wäre nur in einer mündlichen Verhandlung möglich gewesen. In einem Beschluss liegt der richterliche Befehl allein im Tenor. Ein solches Vorgehen – den Prozessbevollmächtigen im Beschluss-Tenor anzuweisen, KI auf eine bestimmte Art einzusetzen – hätte mit dem Streitgegenstand nichts zu tun gehabt und wäre mit Sicherheit öffentlich massiv kritisiert worden, nicht nur von Experten des anwaltlichen Berufsrechts. Es hatte daher einen triftigen rechtlichen Grund, weshalb der Richter die Begründung des Beschlusses für ein „obiter dictum“ nutzte. Er hatte etwas mitzuteilen, wollte und durfte dies aber nicht in justiziabler Art und Weise tun. Römermann verkennt die Motivation, wenn er meint, der Richter habe „seinem Ärger über den ungeprüften Einsatz von KI bei der Erstellung eines Anwaltsschriftsatzes publikumswirksam Luft“ machen wollen. In welcher Verfasstheit der Richter war, als er seinen Beschluss abfasste, wissen wir nicht. Die Argumentation lässt keine Rückschlüsse auf einen Überschuss an Emotionalität zu. Dagegen erscheint es, wie oben beschrieben, sinnvoll und womöglich geboten, von Zeit zu Zeit an die Kooperationspflicht eines Anwalts beim Dialog über das Recht zu erinnern. Es gibt zwar eine Alternative. Die wäre aber schlecht. Denn wie genau hätte man sich eine Verrechtlichung des anwaltlichen KI-Einsatzes vorzustellen?
Beispielsweise so: Ein Prozessbevollmächtigter sieht im Verhalten des gegnerischen Anwaltskollegen den Versuch, das Gericht zu täuschen. Er stellt Strafanzeige wegen Prozessbetrugs. Je nach Konstellation – die Rechtsprechung dazu ist fein austariert – nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Um herauszufinden, mit welcher Zielsetzung die KI eingesetzt wurde, wird die IT der betroffenen Anwaltskanzlei beschlagnahmt. Es folgt ein Aufschrei in der Öffentlichkeit, die sich fragt: Wo kommen wir da hin? Es folgt eine erregte Debatte, an deren Ende der Gesetzgeber zum Einschreiten aufgerufen wird. Was macht nun der Gesetzgeber? Er schafft die Rechtsanwaltskammern ab und unterstellt die Anwaltschaft der Gewerbeaufsicht. In der Gesetzesbegründung ist nachzulesen, dass dieser Weg alternativlos ist, weil die Selbstverwaltung der Anwaltschaft gescheitert sei. Der Anwaltsberuf wird zum zulassungspflichtigen Gewerbe, als speziell normierter Gefahrenberuf. Der dahinterstehende Gedankengang erscheint plausibel: Wenn der Staat schon kontrollierend eingreifen muss, will er auch die Aufsichtsbehörde stellen. Entscheidend für die Frage der Zuverlässigkeit wird dann mittelfristig aller Voraussicht nach weniger der aufgebaute Wissensschatz sein als der adäquate Umgang mit KI-Anwendungen. Damit schließt sich der Kreis: Anwälte, die ihre Prompts zur Erstellung eines KI-generierten Schriftsatzes nicht fälschungssicher archiviert haben, müssen mit einem Bußgeld rechnen, das Beamten festsetzen, die keinerlei Bezug zur Rechtspflege haben. § 43 BRAO spielt dann garantiert keine Rolle mehr, genauso wie heute, nur aus anderen Gründen.
Anwaltliche Gewerbeaufsicht: Schreckens- oder Zukunftsszenario?
Zugegeben, die anwaltliche Gewerbeaufsicht ist ein Extremszenario der Verrechtlichung. Gegenwärtig erscheint es als unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Das könnte aber auch am Langmut der Öffentlichkeit liegen, die es sich noch gefallen lässt, dass wichtige Kernanliegen der Rechtspflege im Alltag der Rechtsanwendung nicht adressiert werden. Man sollte Langmut aber nicht mit Lethargie verwechseln. Der Appell des Richters am Amtsgericht Köln sollte ernstgenommen werden, nicht nur vom Allgemeinpublikum, auch von Berufsträgern – und von Berufsrechtlern. Denn wie Rechtsanwälte mit normativen Vorgaben umgehen, ist mittel- und langfristig entscheidend für die Akzeptanz des Berufsbilds.
Das bedeutet nicht, dass Römermann mit seiner Kritik am Würdebegriff, wie er in § 43 BRAO niedergelegt ist, daneben liegt. Wer Rechtsanwälten bei ihrer Berufsausübung Vorgaben machen will, braucht dafür eine Rechtsgrundlage, die präzise ist, nicht schwammig. Für Professionsangehörige ist aber eine andere Fragestellung entscheidend: Wie sollte eine gute Rechtspraxis aussehen? Wenn es stimmt, dass das Bemühen um eine gute Rechtspraxis Teil der (richterlichen und) rechtsanwaltlichen Berufsausübung ist, lässt sich gegen einen Aufruf zur Einhaltung der Arbeitsgrundlage unter Rechtsanwendern nichts einwenden. Die Kritik Römermanns, dass es angeblich keine legitime Anwendung der zentralen Berufsnorm der Anwaltschaft gebe, ist an die Selbstverwaltungskörperschaften zu richten. Den Anwaltskammern ist es bislang in der Tat nicht gelungen, den Begriff der anwaltlichen Würde mit Leben zu füllen – außerhalb von Sonntagsreden und Jubiläumsfeiern. Zu glauben, es sei in erster Linie die Aufgabe des Gesetzgebers, daran etwas zu ändern, ist allerdings ein Kardinalsfehler der Anwaltsprofession. Denn diese Meinung könnte dazu führen, dass der Gesetzgeber die oben skizzierte Schlussfolgerung zieht: Die Anwälte bekommen es nicht hin, die Grundlagen des Dialogs, den sie im Sinn der Rechtspflege führen sollen, selbst zu definieren. Dann macht das eben die Gewerbeaufsicht, die aus Gründen des funktionalen Sachzusammenhangs etwa an das Bundesamt für Justiz übertragen werden könnte. Ein Alptraumszenario für die Anwaltschaft? Hoffentlich. Denn die Verrechtlichung führt zur De-Autonomisierung, einem schleichenden Prozess, der die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst entfremdet. Aber wenn dieser Prozess aufgehalten werden soll, wo sind dann die Bemühungen dazu? Sie lassen sich nicht in Sonntagsreden und Jubiläen auslagern. Es ist der Alltag der Rechtsanwendung, der über die Zukunft der anwaltlichen Selbstverwaltung entscheiden wird.
Anwaltliches Berufsrecht ohne Deontologie: Ein Selbstwiderspruch
Die Schlussfolgerung aus der deontologischen Kritik an der berufsrechtlichen Kritik der richterlichen Kritik ist: Freiberuflich denkende, dem anwaltlichen Berufsethos verpflichtete Rechtsanwälte sollten froh sein, dass es beim Amtsgericht Köln Richter gibt, die ihrer Profession nach wie vor zutrauen, an einem auf den Rechtsfrieden ausgerichteten Dialog in der Rechtsanwendung interessiert zu sein. Aber wie lange wird das noch der Fall sein, wenn sich der Eindruck festsetzt, dass die Anwaltschaft die Grundlagen der Freiberuflichkeit selbst untergräbt, sei es durch Desinteresse, sei es durch die Zurückweisung des Appells zum Dialog?